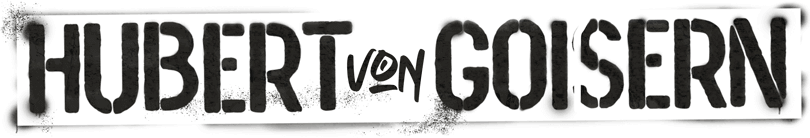FEDERN
Der amerikanische Albtraum
Heast as nit, wia die Zeit vergeht: Seit über 25 Jahren bereichert der Weltmusiker Hubert von Goisern das Showgeschäft mit kulturübergreifenden Melodien und ehrlichen aber fordernden Texten. Im Frühjahr ist die biographische Dokumentation Brenna tuat's schon lang über den oberösterreichischen Völkerverständiger erschienen, mit seinem aktuellen Federn spielt er diesen Sommer auf der Burg Clam und in Wiesen. VOLUME hat mit Hubert von Goisern über Vorbildfunktionen, seine Ehrenbürgerschaft und den amerikanischen Albtraum nachgedacht.
Berechtigte Frage: Wieso war es im Jahr 2015 an der Zeit, einen Dokumentarfilm über das bisherige Leben von Hubert von Goisern zu veröffentlichen?
Mein Manager Hage Hein hat sich eingebildet, dass es einen Film über meinen Werdegang braucht. Damit wollte er schon zu meinem 60. Geburtstag fertig sein, jedoch hat ihn die Fülle des Archivmaterials erschlagen. Ich konnte und wollte ihn bei diesem Projekt nicht unterstützen. Natürlich ehrt es mich, wenn jemand sich die Mühe macht, eine Dokumentation über mich zu verfilmen. Aber es ist auch peinlich, aktiv daran mitzuarbeiten. Den einzigen Rat, den ich ihn geben konnte: "Such dir einen professionellen Filmemacher, der dich unterstützt!". Umso mehr hat es mich gefreut, dass er den Rosi (Anm d. Red.: Marcus H. Rosenmüller) als Regisseur gewinnen konnte. Somit war klar: Der Film wird gut, auch wenn mir nicht gefällt, was darin vorkommt.
Eine der ersten Szenen in Brenna tuat's schon lang: Du triffst auf deinen Mentor, Sepp Atzmanstorfer. Für wen übernimmt Hubert von Goisern die Vorbildfunktion?
Das weiß ich nicht! Der Sepp hat ja bis vor kurzem auch nicht gewusst, welche Rolle er in meinem musikalischen Werdegang gespielt hat – verstehen tut er's bis heute nicht. Was wahrscheinlich auch an seiner sehr bescheidenen Art liegt. Ist ja auch komisch, wenn dir jemand offenbart, dass du seine bzw. ihre künstlerische Motivation bist. Hier bedarf es einem nötigen Respektabstand. Darum halte ich es schon immer so: Wenn ich Vorbild sein möchte, dann nur in der Form, dass ich Leute dazu ermutige, das zu tun, was sie in sich spüren.
Nach über 25 erfolgreichen Jahren im Musikgeschäft: Wäre es dir heute immer noch peinlich, wenn dir deine Heimatstadt Bad Goisern ein Denkmal setzen würde?
Nachdem ich bereits seit elf Jahren Ehrenbürger dieser Stadt bin, ist ein Denkmal nicht mehr nötig. Hoffentlich! (lacht)
Was bedeutet dir diese Ehrenbürgerschaft?
Bitte, ich will da am besten gar nicht drüber reden! (lacht) Teddy Podgorski hat einen sehr passenden Spruch dafür: "Es gibt nur eins, was noch peinlicher ist als eine Ehrung anzunehmen – nämlich sie abzulehnen!". Ich bin übrigens der erste Ehrenbürger, dessen Nominierung nicht einstimmig erfolgt ist – die freiheitlichen Mandatare waren alle gegen meine Auszeichnung. Das macht die ganze Angelegenheit schon wieder erträglicher...
Du hast deinen Manager bereits erwähnt, Hage Hein aus München. Wo wäre Hubert von Goisern heute, wenn er nie diesem Menschen begegnet wäre?
Schwer zu sagen, denn zum Glück ist diese Begegnung ja passiert. Hage und ich haben uns sofort bestens verstanden, mussten aber im Laufe der Jahre auch harte Kämpfe austragen, die unsere Zusammenarbeit immer wieder fast ans Ende brachten. Aber das gehört dazu und belebt die Beziehung! Für mich gibt's keine Alternative zu Hage – wenn ich mit diesem Typen nicht mehr kann, dann höre ich auf!
Es geht noch immer munter weiter: Du hast gerade dein neues Studioalbum Federn veröffentlicht, entstanden in den Südstaaten von Amerika. Warum diese Musikreise?
Schon während unserer letzten Tournee und meiner anschließenden Kreativpause hat mich die offensichtliche Entfremdung zwischen Amerika und Europa sehr beschäftigt. Darum bin ich danach über den großen Teich geflogen, um dort länger Zeit zu verbringen und um zu versuchen, eine kulturelle Brücke zu schlagen. Das sollte mein Beitrag werden, dass sich wenigstens ein paar Menschen wieder annähern und dieses gegenseitige Unverständnis verschwindet. Reisedestinationen waren unter anderem Nashville und New Orleans, also dort, wo Country und Blues gelebt werden. Hier war ich vorher außerdem noch nie...
Hat dieser Brückenschlag funktioniert?
Ganz im Gegenteil, ich bin noch entfremdeter zurückgekehrt als ich vor meiner Abreise schon war. Amerika ist nicht gleich Amerika, aber diese Eigenschaft zieht sich durch das ganze Land: Die meisten Menschen dort leiden unter maßloser Selbstüberschätzung! Ich halte diese Angeberei überhaupt nicht aus. Jeder erzählt dir von großen Plänen und wie toll er bzw. sie ist. Nach kurzer Zeit kommt man aber relativ leicht drauf, dass dahinter rein gar nichts steckt. Das hat meinen Aufenthalt sehr getrübt. Genau vor einem Jahr im Juni war ich schon fast so weit, dass ganze Albumprojekt einzustampfen.
Was hat Federn gerettet?
Die Tatsache, dass ich meiner Band versprochen habe, im Herbst 2014 auf Tour zu gehen. Vorher hätte die Platte erscheinen sollen, ich habe die Veröffentlichung verhindert, wollte dieses Scheißprogramm aber dennoch live versuchen und spielen. Das war die Rettung bzw. die Geburtsstunde von Federn: Denn beim Proben und Spielen sind wir dann alle drauf gekommen wie geil dieses Material ist. Nach ein paar Adaptionen und Korrekturen bin ich jetzt davon überzeugt, dass Federn eines der besten Alben meiner Karriere ist.
"Eine flache Landschaft macht mich depressiv"
Als wir Hubert von Goisern in einem Münchner Café treffen, hat der 62-Jährige bereits einen eineinhalbtägigen Interview-Marathon hinter sich. Gerade ist die Doku Brenna tuat's schon lang über ihn herausgekommen, das neue Album Federn folgt wenige Tage später. Dementsprechend müde, aber zufrieden wirkt der alpine Weltmusiker.
Auf welchem Berg waren Sie zuletzt?
Mein letzter Berg hatte keinen Namen: Er steht in Grönland und ich habe ihn mit Ski bestiegen – zusammen mit Alexander Huber.
Mit dem Huberbua? Wie kam es dazu?
Ein Filmprojekt von Servus TV Bergwelten hat uns zusammengebracht: Ich wollte mein schon länger laufendes Projekt mit den Inuit weiterführen und dabei auch das erste Konzert meiner Tournee spielen, er wollte in die arktischen Berge. Wir kannten einander aber schon länger, von daher hat mir die Idee, mit ihm zusammen in Grönland unterwegs zu sein, gut gefallen.
Was bedeuten Ihnen die Berge?
Die Berge bedeuten für mich Herausforderung. Sie bedeuten Schutz. Sie geben der Landschaft eine Form. Eine vollkommen flache Landschaft macht mich depressiv. Ich brauche Berge über kurz oder lang. Ohne Berge lasse ich alles hängen.
Ist es das Wandern und Bergsteigen, wozu Sie die Berge brauchen, oder reichen sie Ihnen auch als Kulisse?
Ich möchte mich schon in ihnen bewegen. Ich steige beispielsweise hinauf, um mir einen Überblick zu verschaffen. Ich will einfach hochgehen und schauen: Aha, das sieht so aus, da könnte ich mal hingehen ... Wenn es flach ist in alle Richtungen, das ist das Bedrohlichste für mich. In den Bergen herrscht – zumindest dem Idealbild nach – Stille.
Sie hätten fast den Elias in Vilsmaiers Schlafes Bruder-Verfilmung gespielt. Kennen Sie diesen Zustand von Elias: In der Stille alles hören?
Ja. Aber ich bin mir dessen schon bewusst, dass ich mich höre und hab da keine Fantasie wie der Elias, dass das irgendwas Göttliches wäre. Es ist nicht so, dass ich nicht an Gott glaube! Wenn ich in den Wald gehe, kann es schon sein, dass ich einen Baum sprechen höre. Aber ich weiß, dass das in mir ist. Ich kann akzeptieren, dass ich denke: Das sagt jetzt der Baum. Vielleicht ist es einfach so, dass der Baum in mir durch mich zu mir spricht oder so etwas. Das mögen auch alles Einbildungen sein. Ich denke da nicht so viel drüber nach.
Aber Sie hören etwas, auch wenn es rein objektiv um Sie herum still ist?
Ich höre dauernd Musik in mir. Ich brauch kein Radio. Wenn ich nicht spreche, dann (macht ein Zeichen mit den Händen um seinen Kopf) läuft es hier drin ab. Manchmal ein blöder Ohrwurm von jemand anderem. Manchmal ein blöder Ohrwurm von mir selbst. Manchmal etwas, was ich noch gar nicht kenne. Dann denke ich: Ha, da könntest du ein Ding draus machen.
Ist das Ihre einzige Quelle der Inspiration?
Ja natürlich, ich hab nur einen Kopf.
Und die anderen Kulturen, in denen Sie unterwegs waren und sind? Suchen Sie dort nicht nach Inspiration?
Nein, überhaupt nicht. Ich höre einfach zu, alles läuft in mich rein. Im kreativen Prozess gibt es ein Ventil, das ich aufmache, und dann kommt alles Mögliche wieder raus. Ich weiß oft gar nicht, wo das her ist, wo ich das eingesammelt hab. Ich komponiere auch nicht in der Natur.
Warum nicht?
Ich finde, die Natur genügt sich selbst. Wenn ich in der Natur bin, hab ich nicht das Gefühl, dass ich da jetzt selber was dazu beitragen mag. Ich mag die Vögel, ich mag den Wind hören, das Rauschen des Wassers, das Summen der Insekten ... das finde ich alles eine perfekte Symphonie. Warum soll ich da noch irgendeinen Ton hinzusetzen? Ich hatte noch nie das Bedürfnis, dass ich mich irgendwo oben auf den Berg hinstelle und singe.
Wie schaffen Sie es, dass man Sie trotz Salzburger Dialekt auch in Norddeutschland, in Osteuropa oder gar Afrika versteht und Sie dort mit Ihrer Musik ankommen?
Das ist die Musik. Sie ist eine universelle Sprache. Die Stimme ist ein unheimlich wahrhaftiges Instrument. Wenn ich etwas singe, dann bin ich da ganz in dieser Geschichte, ich möchte sie erzählen, so wie ich jetzt beim Reden etwas erzähle. Zusammen mit der Musik, mit den Harmonien, mit der Dynamik, mit der Kraft, die da drin steckt und auch mit der Zärtlichkeit, kann ich auch Menschen auf die Reise mitnehmen, die meine Sprache nicht verstehen.
Aber den Inhalt, die fremde Sprache verstehen die Menschen doch nicht, oder?
Vor vielen Jahren habe ich Jane Goodall einmal nach Ischl eingeladen für einen Vortrag. Sie hat eineinhalb Stunden gesprochen und vielleicht zehn Dias gezeigt, die eher symbolhaft waren. Nach dem Applaus kam ein Freund auf mich zu und hat gesagt: "Weißt Du, ich versteh kein Wort Englisch, aber ich hab das Gefühl, ich hab alles verstanden, was sie gesagt hat." Das kann man, wenn man die Worte nicht nur als Hülsen rauslässt, sondern wenn die mit Leben daherkommen. Dann funktioniert das.
Andersherum gefragt: Können Sie die Worte einer fremden Sprache mit Leben füllen?
Es gibt natürlich Leute, die schaffen es – und das sind gar nicht so wenige – in einer fremden Sprache zu singen. Für mich ist Hochdeutsch schon eine Fremdsprache, ich tu mir da sehr schwer, ich hab es manchmal versucht ... (lacht) Es kommt immer komisch rüber. Jetzt beim Reden kann ich es inzwischen schon, aber wenn ich singe, dann bekommt das was unangenehm Pathetisches.
Trotzdem singen Sie auch auf Englisch.
Auf der neuen Platte gibt es ein Lied, von dem zwei Strophen in Englisch sind. Ich hab es ganz in Englisch geschrieben, ursprünglich. Eigentlich wollte ich mehr englische Texte schreiben. Dann fand ich meinen Gesang furchtbar! Und kaum sing ich in Deutsch: Erleichterung! Jetzt ist nur mehr die dritte Strophe dieses Liedes auf Deutsch, es ist wie die Auflösung. Deshalb hab ich die anderen englischen Texte gar nicht mehr weiterverfolgt. Weil ich im Gegensatz dazu spüre, wie wahrhaftig ich werde, wenn ich in meiner Sprache singe.
Woher kam dann die Absicht, ein Lied in Englisch zu verfassen?
Weil ich mich in der ganzen Vorbereitungszeit in Amerika aufgehalten und mit Musikern zusammengearbeitet habe, die nur englisch reden. Es gab und gibt auch die Vision, mit dieser Musik, dieser alpinisierten amerikanischen Musik eines Tages hinüber zu gehen und in Amerika eine kleine Tour zu spielen. Und da hab ich mir gedacht, es wäre einfach schön, wenn es ein paar Lieder gibt, die ich in der Sprache singe, die die Leute dort verstehen.
Die Einheimischen also in ihrer Tradition wahrnehmen und abholen ... Was macht die Faszination von Tradition aus?
Traditionen sind wichtig für die Identität – nicht nur für die persönliche, sondern auch die der Gesellschaft, in der man lebt. Man möchte sich ja eingebettet fühlen, man möchte wo dazu gehören, nicht jeder will gern sein eigenes Süppchen köcheln. Dafür gibt es momentan in der Gesellschaft aber ganz schön viele, die ihr eigenes Süppchen köcheln. Das Ego wird in den letzten zehn, 20 Jahren wahnsinnig gefördert. Es gibt immer mehr Single-Haushalte, immer weniger Leute, die wirklich zusammen wohnen. Ich finde, das ist eine Fehlentwicklung, denn die Gemeinschaft macht uns stark und sicher. Das Leben ist einfach viel leichter, wenn man aus dieser Sicherheit heraus agieren kann, als wenn du als Einzelgänger, als Eremit irgendwo bist.
Diejenigen, die in abgeschotteten Alpentälern oder auf einsamen Gipfeln glücklich sind, suchen wohl eher das Eremitentum.
Das mögen Bedürfnisse sein, die wir auch spüren und auch manchmal brauchen für einen Abschnitt unseres Lebens. Aber das Zusammensein ist viel spannender, man kann vom anderen lernen; es braucht nicht jeder jeden Fehler machen, man kann sich inspirieren lassen. Für dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dieses Wir-Gefühl sind die Traditionen ganz wichtig. Aber sie haben halt auch etwas Ausschließendes, Abgrenzendes.
Haben es die Menschen in den Alpen einfacher mit dem Wir-Gefühl, weil die Berge natürliche Grenzen setzen?
Wir haben in den Alpen das Phänomen, dass in fast jedem Tal eine andere Kultur herrscht. Natürlich sind diese Kulturen verwandt, und ein paar Menschen sind schon immer gereist. Aber es war ein karges Leben, so viel zu teilen gab es da nicht. Deshalb mussten sie sich schon abgrenzen: bis hierher und nicht weiter, das ist meine Rübe! Aber man kann alles übertreiben. In meiner Jugendzeit, in den 1960er-Jahren, da gab es eine Nachbarin, man nannte sie die Zugereiste. Sie war damals 90 Jahre alt, hatte 70 Jahre vorher von Gosau – das ist 15 Kilometer entfernt – nach Goisern geheiratet.
Ging es Ihnen ähnlich, waren Sie in Goisern auch ein Zugereister?
Meine Großeltern mütterlicherseits stammen aus dem Sudetenland und sind als Flüchtlinge 1945 nach Goisern gekommen. Ich bin von kleinauf dort aufgewachsen. Aber ja, ich war ein Außenseiter.
Was ist für Sie Heimat?
Da wo die Familie ist, wo die engsten Freunde sind. Und die Natur. Die Natur ist auch so etwas wie Heimat, egal wo ich bin. Ob das jetzt Grönland ist oder ob ich am Pazifik stehe und aufs Meer hinaus schaue und die Berge hinter mir habe. Natur ist so etwas wie ein Zuhause für mich, da fühle ich mich geborgen, da kann ich mich hineinfühlen. Da fühle ich die Fische, die Bäume und die Insekten, da bin ich eins mit allem.
Selbst in einer Landschaft, die Ihnen nicht vertraut ist?
Ja.
"Country aus Nashville ist wie Tinnitus"
Hubert von Goisern war in Amerika und hat neue Erfahrungen mitgebracht
 Wenn es den echten Alpenrocker gibt, dann ist es Hubert von Goisern. Der umtriebige Weltenbummler, der Südafrika ebenso kennt wie Tibet und Kanada, der mit Musikern aus aller Herren Ländern zusammenspielte und sich dabei auf immer neues Terrain vorwagte, ohne dabei seine Wurzeln zu vergessen, ist beliebter denn je und füllt die Säle und Arenen auf seinen Tourneen mühelos. Neuestes Kind seiner musikalischen Passion und Experimentierlust ist Federn und das Resultat eines einmonatigen Trips über den großen Teich. Nach Nashville und New Orleans, wo er hoffte, entweder Klischees bestätigt, aber lieber noch sie widerlegt zu bekommen. Wie es dem Mann aus Goisern erging und weshalb trotz einiger Ernüchterung über die US-Musikszene trotzdem ein tiefgreifendes Album herausgekommen ist, erzählt der 62-Jährige bei einem Besuch im BNN-Verlagsgebäude in Karlsruhe-Neureut.
Wenn es den echten Alpenrocker gibt, dann ist es Hubert von Goisern. Der umtriebige Weltenbummler, der Südafrika ebenso kennt wie Tibet und Kanada, der mit Musikern aus aller Herren Ländern zusammenspielte und sich dabei auf immer neues Terrain vorwagte, ohne dabei seine Wurzeln zu vergessen, ist beliebter denn je und füllt die Säle und Arenen auf seinen Tourneen mühelos. Neuestes Kind seiner musikalischen Passion und Experimentierlust ist Federn und das Resultat eines einmonatigen Trips über den großen Teich. Nach Nashville und New Orleans, wo er hoffte, entweder Klischees bestätigt, aber lieber noch sie widerlegt zu bekommen. Wie es dem Mann aus Goisern erging und weshalb trotz einiger Ernüchterung über die US-Musikszene trotzdem ein tiefgreifendes Album herausgekommen ist, erzählt der 62-Jährige bei einem Besuch im BNN-Verlagsgebäude in Karlsruhe-Neureut.
Warum nun die USA? Um Vorurteile bestätigt zu bekommen oder um zu sehen, dass es doch anders ist?
Die Hoffnung war schon, dass ich diese Vorurteile ausräumen kann, sie haben sich dann allerdings eher potenziert als halbiert. Wichtig war mir eigentlich, eine persönliche Brücke zu schlagen und Beziehungen und Freundschaften aufzubauen. Und um dieser Verallgemeinerung entgegenzuwirken, also dass man etwa sagt: die Europäer sind so, die Amerikaner sind so.
Und was haben Sie festgestellt?
New York ist nicht Amerika. New Orleans ist nicht Amerika. L.A. ist nicht Amerika. Das Grundgefühl dieser Nation findet man aber im Midwest und im so genannten "Bible Belt". Das ist auch das Heim der Countrymusik. Und dort habe ich eine unglaubliche Armut kennengelernt, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Man denkt eigentlich: Amerika ist doch eins der reichsten Länder, wenn nicht das fortschrittlichste und modernste Land der Welt, es schickt Satelliten und Raumschiffe hinaus, es hat unglaubliche Geistesgrößen, auch kritische Geister und großartige Literaten und Musiker hervorgebracht. Aber im Detail funktioniert das Ganze gar nicht. Das war schon erschütternd, das hätt' ich nicht erwartet. Dort ist auch eine unglaubliche Ignoranz zuhause, ein Nichtwissen über das, was außerhalb Amerikas passiert. Es war entsprechend schwer, da auch Kontakte zu knüpfen. Ein paar sind dann aber doch passiert, Gott sei Dank. Mit dem Pedalsteelgitarristen Steve Fishell konnte ich einen großartigen Musiker sogar dafür begeistern, mit mir zurückzufahren. Auch jetzt auf der Tour haben wir einen Pedalsteeler dabei, Bob Bernstein. Ich bin sehr froh, dass es wenigstens ein paar Musiker gibt, die sagen, das ist ein spannendes Abenteuer, da möchte ich mitmachen.
Sind die Amis für solche Abenteuer im Allgemeinen nicht zu haben? Welche Erfahrungen haben Sie vor Ort gemacht? War's wenigstens spannend so mit anderen Musikern?
Am spannendsten war's in der Fantasie, in der Realität war's eher mühsam, weil da einfach die Neugier nicht groß ist. Es interessiert dort die wenigsten, was es sonst noch gibt auf der Welt. Das ist ein Land, eine Gesellschaft, eine Musikszene, da funktioniert alles auf der Basis des Geldes. So was hab ich in dieser extremen Form noch nie erlebt. Da ist jeder käuflich. Wenn du sagst: ich möchte gern ..., dann fragt der andere: was brauchst du, brauchst du einen Gitarristen, einen Steeler oder eine Bassisten? Brauchst es nur zu sagen, ich kann dir genug nennen, die gut sind. Die machen das zu einem gewerkschaftlich vorgeschriebenen Tarif. Da fragt keiner, was willst du überhaupt machen, da hört sich keiner die Musik an, sagt dann, das gefällt mir nicht oder da möchte ich gern dabei sein. Das ist denen völlig wurscht. Das ist ein Job. Ich fand das sehr befremdlich. Kurz bevor ich drüben war, hat Eric Clapton in Nashville produziert und dann eine Tour gespielt. Und die meisten Musiker, die dabei waren, haben gesagt, nein, auf Tour gehe ich nicht, das interessiert mich nicht. Man denkt doch: Touren, da ist das Leben, auf die Bühne gehen, da spielt man für die Leut', da entsteht was. Aber nein.
Noch mehr negative Erfahrungen, zum Beispiel in der Country-Hochburg Nashville?
Ja. In Nashville, in dieser berühmten Straße, wo ein Club neben dem anderen ist, wo im Stundentakt die Acts wechseln, da klingt alles gleich. Das ist wie ein Tinnitus.
Der Normalmensch denkt doch: Wow, Nashville, das muss doch inspirierend sein ...
Nein das ist nicht inspirierend, die Kreativität ist dort nicht zuhause. Es gibt großartige Studios, du hast dort die besten Mikrofone, das modernste Equipment. Du hast Musiker für jedes Instrument. Für jedes einen Champion. Du hast die ganzen Labels dort, die Agenturen. Das ist wirklich eine Industrie, aber es ist nicht sehr inspirierend. Nashvilles Aura kommt aus der Vergangenheit. Gut, es gibt noch Leute wie Emmylou Harris, die in Nashville lebt, und der ... der, na, wie heißt der mit den langen Haaren ... der ist auch schon 80 Jahre alt ...
Willie Nelson?
Ja, genau der. Und viele andere auch. Die leben dort irgendwo zurückgezogen, besitzen ein Häuschen, treten aber so gut wie nicht mehr in Erscheinung. Die produzieren ab und zu noch etwas und das war's. Nashville atmet nur noch die Aura eines Hank Williams oder einer Patsy Cline. Die Aura der Fünfziger und Sechziger eben. Und aus deren Liedern schöpft man heute noch. Doch das sind alles nur Blaupausen. Inzwischen wird dort ja auch ziemlich viel Pop produziert.
Um das zu finden, was ich gesucht hab, hätte ich eigentlich nach Austin/Texas gehen sollen. Ich hab das gewusst, aber ich wollt da nicht hin. Ich wollte in dieses Epizentrum der Countrymusik. Ich wollte an den Wurzeln andocken und nicht in der gegenwärtigen Countrymusik. Ich wollte da das Alte entdecken. Doch da sind nur die Bluegrasser. Das sind Taliban, wie bei uns zuhause die in Anführungszeichen echten Volksmusiker, wo keine Abweichung toleriert wird. Das hab' ich halt erfahren müssen und das hab ich irgendwie auch gebraucht.
Es war es also wert?
Auf jeden Fall. Allein schon die Begegnung mit Steve Fishell. Den hab ich gleich am ersten Tag kennengelernt. Insgesamt hab ich ja bestimmt einen Monat in Amerika verbracht, aber außer Steve ist da eigentlich nichts mehr dazugekommen. Ich hätte also schon nach dem ersten Tag wieder zurückfahren können, wenn ich das gewusst hätte.
Letzten Endes war es, wenn man Federn mit seinen Blues und Country getränkten Liedern so hört, aber doch genug Inspiration für ein Album, oder?
Ja, die Inspiration hat sich schon eingestellt. Die Idee für dieses erste Lied Snowdown ist mir übrigens auf dem Weg von Nashville nach New Orleans gekommen.
Wie muss man sich so einen Entstehungsprozess vorstellen? Lässt sich das überhaupt in Worte fassen?
Nein, überhaupt nicht. In dieser Phase bin ich quasi Passagier meiner eigenen Kreativität.
Es passiert also einfach?
Ja genau, ich starte die Maschine und dann hebt sie ab und ich schau, was da alles daher kommt und trenn die Spreu vom Weizen der Gedanken und Ideen. Es kommt ja auch viel Blödsinn daher.
Apropos: Ein paar Mal kommt das Wort Schnaps in den Liedern vor, ein Song heißt sogar explizit so. Was hat es damit auf sich?
Ich mag Schnaps eigentlich nicht, bin eher so der Weintrinker. Schnaps war aber so etwas wie die Initiierung für Steve Fishell, als der von Nashville mit nach Österreich kam. Der litt noch ziemlich unter Jetlag, wollte aber gleich ins Studio gehen. Halt, hab ich zu ihm gesagt, komm erst mal runter. Wir sind dann ein bisschen rumgefahren, ich hab' ihm die Gegend gezeigt. Schließlich wollte er, um sich in den Schlaf zu beamen, eine Flasche Wodka kaufen, worauf ich g'sagt hab, Wodka kannst du irgendwo anders kaufen. Aber wenn du so was brauchst, gehen wir zu 'nem Freund von mir, der ist Schnapsbrenner. Das wollt' er nicht. Schnaps gibt's in Amerika auch, aber das ist so was Fürchterliches, 30-prozentiger Fusel, mit Chemie auf Pfefferminze oder Pfirsich getrimmt. Nein, sowas wollte er nicht. Bis ich ihn aufgeklärt hab, dass er 'ne falsche Vorstellung von Schnaps hat. Also sind wir erst recht dorthin zu dem Schnapsbrenner, damit das Bild vom Schnaps korrigiert wird. Steve hat ein bisschen gekostet – und am Ende sind wir dort fünf Stunden hängen geblieben, sind gar nicht mehr nach Hause gekommen.
Mit irgendwelchen Nebenwirkungen?
Am nächsten Tag sind wir ins Studio gegangen und, entsprechend bedient, ist mir dann dieses Lied eingefallen. Dieses Lied Schnaps, und auch Corinna. Corinna haben wir dann gleich gespielt, Schnaps hab ich komponiert in dem Zustand. Äh, Corinna heißt ja auf der Platte ganz anders: Des kann's nit sein.
Wie lang war Steve da?
Insgesamt war er dreimal da, wir haben dann auch im Herbst noch eine Tour zusammen gespielt. Es werden, alles zusammen, schon so drei Monate gewesen sein.
Also eine Ausnahmeerscheinung, wenn man an die US-Musiker denkt, wie Sie sie beschrieben haben?
Oh ja! Es hat zwar auch ihn sehr viel Überwindung gekostet, sich auf dieses Abenteuer einzulassen, aber er hat's gemacht.
Und, hat's ihm gefallen?
Absolut. Als das Ganze zu Ende war, stand er ganz fassungslos da, war total ge- und berührt und er meinte, er hätte noch nie so 'ne geile Tour, noch nie so 'ne geile Musik gespielt. Wobei man bei den Amis alles ein bisschen relativieren muss. Die finden ja alles gleich toll, amazing und awesome. Aber ich glaube ihm das. Er hat auch so vom Tourbus geschwärmt und dass die ganze Crew zusammen unterwegs war, dass es keine Hierarchie gibt, wie in Amerika. Auch hat er vom Essen geschwärmt, hat gesagt, dass er noch nie so gut am Stück gegessen hat. Das stimmt auf jeden Fall. Natürlich gibt's auch in Amerika gute Restaurants. Aber bei uns ist schon alles besser.
"Man muss den Zauber der Musik in sich spüren"
Alpenrocker Hubert von Goisern macht am 23. Juli auf seiner Tournee in Esslingen Station
Hubert von Goisern ist ein musikalischer Tausendsassa: Er ist ein begnadeter Liedermacher, er hat sich als Alpenrocker einen Namen gemacht, und er ist stets auf der Suche nach Neuem. Rund um den Globus sammelt er Eindrücke, die er in seine Musik einfließen lässt. Und wenn er ein Album veröffentlicht, ist sein Publikum nie vor Überraschungen sicher. Seine jüngste CD Federn, die eben erst erschienen ist, hat unüberhörbar den Blues. Hubert von Goisern ist in den Südstaaten der USA auf Spurensuche gegangen. Und er ließ sich von Country, Blues und Rock inspirieren, die er in seinen neuen Songs mit seinen alpenländischen Traditionen konfrontiert. Auf der Esslinger Burg ist Hubert von Goisern am 23. Juli zu Gast. Das Konzert wird von Music Circus veranstaltet und von der EZ präsentiert.
Sie haben eine neue CD veröffentlicht und stehen im Mittelpunkt eines Dokumentarfilms. Wie fühlt es sich an, sich auf der Leinwand zu erleben?
Ganz neu ist die Erfahrung nicht, schließlich gibt es schon einen Kinofilm über mich, den Joseph Vilsmaier und Dana Vávrová zum Abschied von den Alpinkatzen gedreht haben. Damals wie heute habe ich gesagt, dass ich keinen Film über mich brauche. Es ist nicht so, dass es in der Vergangenheit nichts zu entdecken gäbe, aber das Hier und Jetzt ist viel zu spannend - davon will ich mich nicht ablenken lassen. Wenn ich den Fokus auf Vergangenes richte, hindert mich das am Weitermachen. Es hat lange gedauert, bis ich dieser Idee etwas abgewinnen konnte. Inzwischen bin ich froh, dass es dieses Filmdokument gibt.
Viele denken bei Ihrem Namen an den Alpenrocker. Ist das ein Etikett, mit dem Sie sich anfreunden können?
Ja, das bezeichnet einen Teil meiner Musik - und meiner Geschichte. In den 90er-Jahren habe ich die Volksmusik auseinandergerissen und ihr die Kraft zurückgegeben, die sie früher mal hatte, ehe sie schwammig und seicht geworden ist durch das Volkstümelnde und Schlagerhafte, das sich in die Volksmusik eingeschlichen hat. Insofern steckt im Alpenrocker vieles von dem, was ich gemacht habe - aber nicht alles.
Könnten Sie sich eher mit der Bezeichnung "alpine Weltmusik" anfreunden? Immerhin bedienen Sie sich in unterschiedlichen Kulturen.
Das liegt auch nicht ganz daneben. Allerdings habe ich mit dem Begriff "Weltmusik" Probleme, weil er sehr inflationär gebraucht wird. Vieles von dem, was man so bezeichnet, ist Allerweltsmusik. Da fehlen oft die Wurzeln. Manche nehmen einfach ein paar Zweige und Blätter und machen daraus etwas Neues, das von überall und nirgends kommen könnte. Mir wär's am liebsten, wenn die Leute einfach sagen würden: Das ist Hubert von Goisern.
Sie haben sich im Lauf der Jahre zahlreiche Fans erobert. Gibt Ihnen der Erfolg mehr innere Freiheit, das zu tun, was Sie wirklich wollen?
Natürlich schwimmt man sich durch den Erfolg auch frei. Was ich in den 90er-Jahren mit den Alpinkatzen gemacht habe, war supererfolgreich, hat mich aber nicht nur befreit. Wirtschaftlich war's befreiend, man bekommt auch Selbstvertrauen, aber es hätte auch sehr einengend sein können. Deshalb habe ich damals bewusst eine Pause gemacht - so lange, bis ich das Gefühl hatte, dass die Leute das einigermaßen vergessen haben und wieder offen waren für etwas Neues.
Sie sind ständig auf der Suche nach Neuem und Innovativem. Macht das Publikum alles mit?
Da müssen Sie das Publikum fragen. Mein Manager Hage Hein hat augenzwinkernd mal gemeint, ich hätte ein sehr leidensfähiges Publikum. Und es stimmt schon: Die Leute gehen mit und sie vertrauen darauf, dass es sie auch interessieren könnte, wenn ich mich mit etwas beschäftige. Das Extremste war sicherlich die Beschäftigung mit tibetischer Musik. Da haben alle Experten erst mal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Am Ende haben wir 100 000 Stück von der CD verkauft. Das zeigt: Wenn man eine Musik macht, die spannend und ehrlich ist, sind die Leute sehr wohl interessiert, etwas anzuhören, das sie noch nie zuvor gehört haben. Es ist falsch, zu denken, dass die Leute immer nur dasselbe haben wollen.
Machen Sie musikalisch keine Kompromisse oder überlegen Sie manchmal auch, wie weit Sie gehen dürfen, damit das Publikum mitgeht?
Ich bediene meinen eigenen Geschmack. Bevor ich etwas mache, wovon ich nicht überzeugt bin, mache ich lieber gar nichts. Man muss immer offen sein, auszuprobieren, was man mag. Inzwischen bin ich aber alt genug, um auch sagen zu können, was ich nicht mag. Das reicht schon mal für die Orientierung.
Würden Sie das auch jungen Kollegen raten: Mach' dein Ding, sonst wirst du nie gut?
Man muss den Zauber der Musik in sich selbst spüren. Wenn du es nicht schaffst, dich mit deiner Musik selbst zu verzaubern, kannst du nicht erwarten, dass du andere damit verzauberst. Du musst als Künstler fühlen, wie deine Musik dich elektrisiert. Du musst die Gänsehaut spüren. Das ist der Weg, den du als Musiker gehen musst: Diese innere Stimme zu hören, diese ganz eigene Melodie, diesen unverwechselbaren Ton - um all das geht's. Und nicht um das, was andere von dir verlangen.
Musik zu hören, kann pures Glück bedeuten. Erlebt man solche Glücksmomente auch, wenn man fast jeden Abend auf der Bühne steht?
Konzerte zu spielen ist das Geilste, was es gibt. Für mich ist das die Belohnung für meine Arbeit, weil ich ganz viel zurück bekomme. Wenn du im Studio stehst und produzierst, empfindest du auch Glücksmomente, wenn etwas gut von der Hand geht. Aber die Phasen, in denen du produktiv und kreativ bist, sind auch der pure Stress, weil du permanent Angst hast, dass dir nichts Gescheites einfällt. Du fängst jeden Tag neu an. Während der Tour bist du wie auf Schienen, alles ist geplant. Wir spielen diesen Sommer 45 Konzerte in 120 Tagen. In jedem normalen Job musst du viel mehr arbeiten. Du wirst in der Nacht zum nächsten Auftrittsort gebracht, und wenn du am nächsten Spielort im Bus aufwachst, beginnst du schon wieder, diese Energie zu spüren. Ich finde das wunderbar.
Drei Monate lang fast jeden Abend pures Glück auf der Bühne: Hält man das überhaupt aus?
Na klar - man schläft ja zwischendurch. Das passt dann schon.
Sagen Sie jetzt nichts, Hubert von Goisern
Volksmusikant Hubert von Goisern im Interview ohne Worte über Tradition,
seinen Ruf als "Alpensozialist" und ein Duett mit Andreas Gabalier.

Ihr Lied "Koa Hiatamadl" hat Sie 1992 berühmt gemacht. Wie viele bessere Lieder haben Sie geschrieben? (1/9)
SZ-Magazin | Foto: © Maximilian GeuterTibet, Grönland, Afrika, Philippinen - Sie reisen ständig. Was finden Sie in der Fremde? (2/9)
SZ-Magazin | Foto: © Maximilian GeuterUnd was bringt Sie doch wieder zurück in die Berge? (3/9)
SZ-Magazin | Foto: © Maximilian GeuterSie haben zwei Kinder. Was können Sie als Vater heute besser als vor zehn Jahren? (4/9)
SZ-Magazin | Foto: © Maximilian GeuterEin echter Volksmusikant tritt nicht im "Musikantenstadl" auf. Richtig? (5/9)
SZ-Magazin | Foto: © Maximilian GeuterLiegt ein Duett mit dem selbst ernannten Volksrock n' Roller Andreas Gabalier im Bereich des Möglichen? (6/9)
SZ-Magazin | Foto: © Maximilian GeuterTradition ist immer auch Ballast. Wie viel davon haben Sie abgeworfen? (7/9)
SZ-Magazin | Foto: © Maximilian GeuterWie groß ist Ihr Glaube an Europa? (8/9)
SZ-Magazin | Foto: © Maximilian GeuterIst Jodeln der Soul von Österreich? (9/9)
SZ-Magazin | Foto: © Maximilian GeuterGeboren: 17. November 1952 in Bad Goisern, Österreich
Beruf: Musiker
Ausbildung: Lehre als Chemielaborant, Musikstudium in Wien
Status: Juhuiiii ridldulio
Musikalisch betrachtet ist Österreich ein gespaltenes Land: Auf der einen Seite sind da Wanda, cool und urban, auf der anderen die Zillertaler Schürzenjäger, volkstümlich und geheimnislos. Dazwischen: leeres Land – und Hubert von Goisern, dem man schon ganz genau zuhören muss, um zu erahnen, was ihn alles treibt und beschäftigt, die Liebe zu den Bergen, die Sehnsucht nach der Welt, der ständige Kampf mit den Deppen da draußen und den Dämonen da drinnen. Klanglich bedient sich Hubert von Goisern aus ganz vielen Welten und setzt die Teile so verwegen zusammen, dass sich die Musik, die dabei herauskommt, nicht schubladisieren lässt.
Er war noch ganz jung, als er beschloss, dass er nicht sein Leben lang in einer Blaskapelle spielen will, also zog er in die Welt, lebte in Südafrika und Kanada, gab Konzerte in Ägypten und reiste nach Tibet, lernte immer noch ein Instrument dazu. Musik, das wurde sein Weg, sich die Welt und die Menschen zu erschließen. Mit dem eher untypischen Lied Koa Hiatamadl gelang ihm der große Durchbruch, vor vier Jahren mit Brenna tuats guat der politischste Wiesn-Hit der Geschichte. Er selbst ist im Moment auf Tour, sein neues Album Federn ist gerade erschienen – zusammen mit dem Film Hubert von Goisern – Brenna tuats schon lang von Marcus H. Rosenmüller.
Doppelkopf: Am Tisch mit Hubert von Goisern, "Alpin-Philosoph"
Weltmusiker, Liedermacher, Protestsänger, Alpenrocker, Hubert von Goisern ist alles und er ist alles gern. Außer Musiker hätte nichts aus ihm werden können, sagt Hubert Achleitner, der sich nach seiner Heimatgemeinde "von Goisern" nennt.
Die Goiserner fanden das nicht immer gut, denn mit seiner Musik geht der Mann mit der Ziehharmonika gern dahin, "wo's weh tut". Musikalisch definiert er "Heimat" und "Volksmusik" neu, in seinen Texten thematisiert er Ungerechtigkeit, Unrecht, Kleingeisterei, Ignoranz und alles andere, worüber man sich aufregen kann. Als Mensch hat er in den letzten Jahrzehnten die Welt bereist und seinen Horizont unendlich erweitert.
Er sei sein roter Faden, sagt er, jetzt ist er wieder da mit einem neuen Album Federn, mit einer Tour, die ihn am 4. Juni auch zum Hessentag führt und mit einem Film, der sehr besonderen Biografie Brenna tuats schon lang. Im Doppelkopf erzählt der Alpin-Philosoph über die Reisen, die Musik, sein letztes Projekt, die Musik und die Menschen der amerikanischen Südstaaten kennen zu lernen und seinen Blick auf die Welt. Ganz einfach über das, was ihn über die 25 Jahre bewegt, wo er im Moment angekommen ist und was da eigentlich brennt.
"Ich habe die Liebe gesucht, nicht den Puff"
Hubert von Goisern hat sich auf seinem neuen Album "Federn" mit Amerika auseinandergesetzt.
Mit der Platte ist er glücklich. Aber den Film über sein Leben hätte er verhindern sollen, findet der Musiker.
Im Juli spielt er auf der Esslinger Burg.
Stuttgart - Der Musiker Hubert von Goisern hat seinen Welterkundungen ein Kapitel hinzugefügt – den Süden der USA. Er wollte Entfremdung überwinden. Doch er ist, sagt er, auf Ignoranz gestoßen.
Herr von Goisern, im Textheft Ihres neuen Albums schreiben Sie, dass Sie zu Inspirationszwecken den Süden der USA bereist haben. Diese Gegend stellt man sich weit weniger exotisch vor als Tibet oder Afrika, wo Sie sich früher schon inspirieren ließen.
Da muss ich widersprechen. Ich fand es in Afrika leichter, Kontakt mit den Menschen aufzunehmen und eine gegenseitige Neugier zu spüren, als im Süden der Vereinigten Staaten.
Auch während Ihrer Donau-Tournee durch Osteuropa vor ein paar Jahren haben Sie beklagt, dass sich manche Musiker vor Ort nicht für den kulturellen Austausch mit Ihnen interessiert hätten, sondern einfach über Sie in Westeuropa Fuß fassen wollten. Ist das der Fluch des Hubert von Goisern?
Nein, in Amerika haben sie nicht einmal daran gedacht, dass ich ein Sprungbrett oder Türöffner nach Europa sein könnte. Da ist mir einfach grundsätzliches Desinteresse und Ignoranz entgegengeschlagen – mit dem Zusatz, dass alle signalisiert haben, für Geld alles zu machen. Mir ging es aber darum, eine gegenseitige Zuneigung und Neugier zu spüren, das Leuchten in den Augen und das Interesse am Du. Ich habe die wahre Liebe gesucht – und nicht den Puff.
Waren Sie naiv?
Ich bin ein unverbesserlicher Romantiker: Wenn ich einen Rückschlag bekomme, ziehe ich mich zurück und nehme mir vor, so etwas nie wieder zu machen. Aber dann komme ich trotzdem wieder in dieselbe Situation, weil ich mir die Welt schönträume und an diese Träume glaube.
Was war überhaupt der Auslöser dafür, dass Sie sich die USA als Inspirationsziel ausgesucht haben?
Der Auslöser war diese Entfremdung zwischen den Vereinigten Staaten und Europa: Ich verstehe nicht mehr, wie die ticken, obwohl das eine Kultur ist, die mich musikalisch sehr beeinflusst hat. Ich verstehe nicht, weshalb die USA zum Beispiel in Libyen oder im Irak verbrannte Erde hinterlassen. Trotzdem dachte ich, ich könnte unserer gemeinsamen Wurzeln wegen an die Country-Musik andocken. In der Handvoll Sessions, die ich dort gemacht habe, hat es auch sofort geflutscht. Aber die Gänsehaut habe nur ich bekommen, sie nicht. Die Amerikaner genügen sich selbst. Die wollen nicht raus.
Zwei Amerikaner nennen Sie auf Ihrem neuen Album trotzdem explizit mit Namen, was Sie sonst nie tun: Eddie und Chelsea für Edward Snowden und Chelsea Manning. Warum wird gerade den beiden Whistleblowern diese seltene Ehre zuteil?
Ich habe mich für diese Platte voll auf Amerika eingelassen, und die beiden gehören mit zu diesem Land, nicht nur der Wahnsinn, die unglaubliche Armut, der ich dort begegnet bin, und die kaputten religiösen Rituale wie Messen mit Giftschlangen: Wenn jemand gebissen wird, dann war er voller Sünde. Dann darf der Arzt nicht kommen, weil entweder Gott ihn rettet, oder der Teufel ihn holt. Aber Edward Snowden und Chelsea Manning zeigen, dass es auch dort Leute gibt, die all das Scheiße finden und sagen, ihr macht was falsch.
Sie haben den beiden ein musikalisches Heldendenkmal geschaffen. Gleichzeitig gibt es seit ein paar Wochen ein filmisches Heldendenkmal für Sie, den Dokumentarfilm Brenna tuat's scho lang. Wie geht es Ihnen damit?
Es geht mir schlecht damit. Hage Hein, mein Manager, hatte diese Idee vor vier Jahren, und ich habe gesagt: "Ich finde das nicht gut, ich mag das eigentlich nicht, aber ich kann dich auch nicht davon abhalten, wenn du das unbedingt machen möchtest. Nur – ich möchte nichts damit zu tun haben." Ich habe nicht daran mitgearbeitet. Nachdem ich den Film dreimal gesehen habe, wusste ich, dass es ein Fehler war, dass ich nicht noch vehementer dagegen war, ihn zu machen. Ich habe ihn zugelassen, weil ich eitel bin, und jetzt bezahle ich dafür, weil mich die Rückschau belastet. Da brechen alte Wunden auf. Der Film zwingt mich, mich über Gebühr mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Es ist, als wenn du dasselbe Schnitzel zwanzigmal essen musst.
Behindert zu viel Vergangenheit die Zukunftsplanung?
Nein, aber die Gegenwart. Nur ein Beispiel: es hat irrsinnig viel Kraft gekostet, damals bei den Alpinkatzen die Reißleine zu ziehen – und dann sieben Jahre nicht auf die Bühne zu gehen. Wenn ich mir das jetzt im Film anschaue, kommt diese ganze Zeit zurück, mit den Zweifeln und den Entscheidungen. Der Schweiß und die Tränen von früher kommen wieder hoch. Aber ich möchte den aktuellen Schweiß riechen und die Tränen in der Gegenwart weinen.
Auf Ihrem neuen Album befinden sich auch ein paar bearbeitete Traditionals und Coverversionen. Sind das Statements gegen die Eitelkeit?
Mir ging es vor allem darum zu zeigen, wie verwandt wir eigentlich sind. Wenn du Amazing Grace unbedarft hörst, würdest du schwören, dass das ein österreichisches Volkslied ist.
Das Lied Amazing Grace, ursprünglich eine Lobpreisung Gottes, haben Sie aus seinem spirituellen Kontext geraubt. Sie machen daraus eine . . .
. . . Lobpreisung des Lebens.
Ist das zulässig?
Ich bin der Meinung, dass Musik größer ist als jede Religion.
Wie bitte? Musik kann keine Antwort darauf geben, was nach dem Tod geschieht.
Das kann sowieso niemand. Die Religion kann es einem nur vormachen. Darum ist Religion nie so groß, wie Musik sein kann.
Aber Sie waren so oft und weit auf der Welt unterwegs, dass Sie sicher bemerkt haben, dass außerhalb Europas nahezu alle Menschen ihrer jeweiligen Religion anhängen.
Ich respektiere das. Aber ich glaube, man muss sich freibeten.
Wir werden uns da wahrscheinlich nicht einigen. Letzte Frage: Machen eigentlich Helden bestimmte Orte zu Heimaten?
Nein, ich glaube nicht, dass es Helden braucht. Es braucht Ereignisse. Die Interpretation heiliger Plätze der Reiseschriftstellerin Alexandra David-Néel, die als Erste Tibet bereist hat, war folgende: Da ist was passiert. Da gab es ein Ereignis. Als sie hundert Jahre alt war, hat sie sich den Pass noch verlängern lassen – ist aber dann ein Jahr später gestorben. Jedenfalls werden diese Plätze durch die Leute, die sie besuchen, konstant aufgeladen mit spiritueller Energie. So ist es mit Heimat auch: Viele Leute laden sie auf, weil dort Dinge passiert sind, die sie toll finden.
Können Sie das bewerkstelligen, indem Sie an der Schiffsanlegestelle in Hallstatt im Salzkammergut ein Konzert geben?
Darüber denke ich nach.