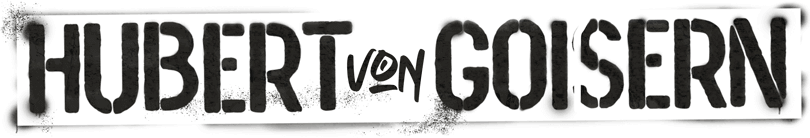ALPHA FORUM INTERVIEW
Alpha Forum mit Hubert von Goisern

Jürgen Seeger: Herzlich willkommen zum heutigen alpha-Forum und herzlich willkommen, Hubert von Goisern, mein heutiger Studiogast.
Hallo, grüß Gott.
Hubert von Goisern, man muss Sie einem breiten Publikum nicht vorstellen, aber vielleicht gibt es doch einige, die Sie noch nicht so gut kennen. Sie sind einer der bedeutendsten österreichischen Musiker unserer Zeit und der Repräsentant der sogenannten Neuen Volksmusik und des Alpen-Rock, bei denen traditionelle Volksmusik, Rockmusik, Jazz, Reggae, Soul usw. miteinander verschmelzen. Was bei Ihnen jedoch ganz besonders auffällt, ist, dass Sie Verknüpfungen suchen, dass Sie das Fremde suchen, dass Sie viel auf Reisen gegangen sind. Erst kürzlich ist wieder ein neues Buch von Ihnen erschienen über Ihre Reisen in die Donauländer: einerseits die Donau runter bis zum Schwarzen Meer und andererseits die Donau hinauf und dann hinüber bis zum Rhein und hinauf bis nach Rotterdam. Andere Reisen haben Sie nach Südafrika geführt, nach Kanada, auf die Philippinen, nach Tansania, nach Tibet, nach Ägypten, auf die Kapverdischen Inseln, den Senegal, nach Burkina Faso oder nach Mali. Aber angefangen hat eigentlich alles in der heimischen Blaskapelle: Da hat das mit der Musik angefangen, mit dem Wissen um die Tradition und mit der Verbundenheit mit der Heimat. Wie hat es denn angefangen mit der Musik? Denn zunächst einmal spielten Sie ja Trompete.
Ja, das war mein erstes Instrument. Ich wollte, seit ich mich erinnern kann, Musiker werden, aber meine Eltern konnten das nicht finanzieren. Es war nicht drin, dass sie mir ein Instrument kaufen oder einen Lehrer für mich bezahlen. Ich war also diesbezüglich ganz mir selbst überlassen. Mit 12 Jahren habe ich mir dann einen Ruck gegeben, bin alleine zur Blaskapelle gegangen und habe gesagt: "Ich möchte gerne Trompete spielen lernen!" Ich bin unendlich dankbar dafür, dass sie mir eine Trompete gegeben haben, die mich nichts gekostet hat, und mir wurde auch ein Lehrer zugeordnet. Ich hatte das große Glück, einen hoch musikalischen Lehrer zu haben, der aber auch die nötige Sanftheit besaß. Das heißt, er hat niemals Druck auf mich ausgeübt, wenn ich nicht geübt habe. Und ich war sehr, sehr faul: Ich habe eigentlich kaum geübt und wollte eigentlich immer nur musizieren und spielen. Darunter haben halt all diese Etüden usw. gelitten, die ich hätte einstudieren sollen. Aber er hat kein einziges Mal gesagt: "Jetzt streng dich mal ein bisschen an, das könnte besser gehen!" Nein, er war immer zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Er saß am Klavier und hat mich begleitet. Für mich war dieser Unterricht immer nur Musik, war immer nur musizieren und ein schönes Erlebnis. Das war in diesem Alter eigentlich das Einzige, vor dem ich mich nicht gefürchtet habe: in die Trompetenstunde zu gehen. Die Schule ansonsten war nämlich für mich ein unglaublicher Stress.
War das ein Ausgleich zur Schule?
Das war reine Freude. Ob das ein Ausgleich war, weiß ich nicht. Ansonsten war ich sehr viel in der Natur und auch die Musik hat meinem verträumten Wesen entsprochen, während die Schule nichts für Träumer ist.
Nach der Trompete kamen noch viele andere Instrumente dazu, u. a. auch das Akkordeon Ihres Großvaters.
Ja, aber das ist dann erst sehr, sehr spät gekommen. Und das war auch kein Akkordeon, sondern eine Ziehharmonika. Das Akkordeon ist dieses Instrument mit den schwarz-weißen Tasten wie bei einer Klaviatur, während es bei einer Ziehharmonika Knöpfe gibt und zumindest die, auf der ich gelernt habe, diatonisch war. Das heißt, wenn man drückt, kommen andere Töne heraus als dann, wenn man zieht. Das ist so ein bisschen wie eine Mundharmonika: halt umgelegt sozusagen auf ein Instrument mit Blasebalg. Dieses Instrument habe ich aber abgelehnt bis ungefähr zu meinem 35. oder auch 37. Lebensjahr. Ich habe diese Ziehharmonika auch nur deshalb in die Hand genommen, weil ich sie kaputtmachen wollte.
Warum?
Ich habe sie gehasst! Für mich war das der Inbegriff des Verstaubten und des Ewiggestrigen, ein Instrument, bei dem immer nur dieselbe Musik herauskommt. Ich aber wollte was anderes: Ich habe immer nach neuen Tönen gesucht, ich wollte etwas Neues hören und machen. Das schien mir mit diesem Instrument unmöglich zu sein. In einem wirklichen Vollrausch – ich hatte sehr viel Schnaps getrunken – wollte ich sie kaputtmachen. Ich war alleine im Haus und dachte mir: "So, jetzt nehme ich sie mal in die Hand und zerreiße dieses blöde Ding!" Beim Versuch, es zu zerreißen, kamen dann aber die wildesten Töne aus diesem Instrument heraus und ich dachte mir: "Ja, warum hat denn bisher noch nie jemand so auf diesem Instrument gespielt? Auf dem kann man doch wirklich Musik spielen!" Ich habe mir das dann in dieser einen Vollrauschnacht reingezogen und stand schon am nächsten Tag auf der Straße und habe Straßenmusik damit gemacht. Ich hatte große Freude daran, etwas entdeckt zu haben, bei dem ich sofort gemerkt habe, dass es vielen Leuten so wie mir geht: Sie sehen dieses Instrument, hören diesen Klang und die Klappe geht runter, weil sie das nicht hören wollen. Warum? Weil wir in einer Zeit aufgewachsen sind, in der eine komplett andere Musik aus dem Radio gekommen ist. Und dann auch noch dieses komische volksmusikalische Drumherum bei diesem Instrument! Das heißt, es war ein Tabu, sich überhaupt damit zu beschäftigen – es sei denn, man war voll in diesem Getto der Tradition drinnen. Wenn man jedoch außerhalb dieses Gettos stand, dann war es eigentlich tabu, sich damit zu beschäftigen. Wenn man es doch gemacht hat, dann haben diejenigen, die in diesem Getto drin waren, von dort heraus geschimpft auf den, der sich da "ihrer" Tradition bemächtigt. Und die, die draußen waren, haben gesagt: "Wenn du das machst, dann geh doch in dieses Getto, denn dann gehörst du nicht mehr zu uns! Wir wollen damit nichts zu tun haben!" Es ist aber selbstverständlich ein großes Glück für einen Künstler, wenn er ein Tabu brechen kann, ein Tabu, an dem sich die Geister scheiden. Und so bin ich dann eben an diesem Instrument drangeblieben und habe mir gedacht: "Ich zeig es denen, dass Volksmusik mehr sein kann als komisches Geschunkel und das permanente Gerede darüber, wie schön es früher gewesen sei."
Das war gewissermaßen ein rauschhaftes, ekstatisches Erlebnis, das zu einem plötzlichen völligen Wandel in der Einstellung gegenüber diesem Instrument geführt hat. Das war für Sie wirklich eine Entdeckung von einem Moment auf den anderen. Entdecken scheint Ihnen überhaupt zu liegen, wenn man sich z. B. all Ihre Reisen anschaut: Sie lassen sich wirklich auf vieles ein. Sie fahren in ferne Länder und lassen sich dort auf die jeweilige Kultur ein und auch auf die dortigen Musiker, mit denen Sie zusammen vor Ort sehr risikobereit auf die Bühne gehen, um zu improvisieren. Wann haben Sie denn diese Lust am Fremden und an der Erfahrung des Fremden für sich selbst entdeckt? War das noch in Goisern?
Ja, das hat bereits in Goisern begonnen. Es hat damit begonnen, dass ich mir z. B. eine Platte gekauft habe, bei der Bluesmusik aus den Lautsprechern kam. Das waren Platten von Alexis Korner, Howlin' Wolf oder Taj Mahal, also Musik vom Ende der 60er Jahre und den beginnenden 70er Jahren. Das war für mich schon etwas ganz Exotisches.
Das war also eine Musik, die auch gleich noch eine fremde Kultur mitgebracht hat.
Ja. Oder denken Sie an die Musik von Ravi Shankar, bei der das ganz extrem der Fall ist: Das ist indische Musik, das sind Ragas usw., bei denen man merkt, dass das mit unserer Musik gar nichts mehr zu tun hat – außer der Tatsache, dass auch das Musik ist. Das, was da bei dieser Musik passiert, läuft eben modal ab und nicht so harmonisiert, wie wir das hier im Westen bei unserer Musik mit ihren Kadenzen kennen. Und dann habe ich Miles Davis für mich entdeckt. Da war ich vollkommen fertig, weil ich mir gedacht habe: "Das ist es!" Und das, obwohl ich überhaupt nicht verstanden habe, was er da gemacht hat oder was da in dieser Musik passiert. Aber es hat mich elektrisiert und ich wollte dahinterkommen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich mir dieses Live-Doppelalbum von Miles Davis wirklich zwei Jahre lang angehört habe und dass ich zwei Jahre lang nicht verstanden habe, worum es da geht. Es hat mich nur elektrisiert, aber ich bin nicht dahintergekommen. Irgendwann hat es dann aber doch "klick" gemacht und ich wusste, wie man musizieren muss, damit genau dieses Gefühl auftaucht. Aber solche Leute konnte ich dann natürlich zu Hause nicht finden und so bin ich aufgebrochen in die Welt.
Wie kam es zu diesem Aufbrechen z. B. nach Südafrika? Denn das war ja wohl im Jahr 1972 Ihre erste große Reise, oder?
Das war im Jahr 1974. Ich wollte einfach nur weg, mir war es egal wohin. Ich wollte nur raus und weg und andere Länder und einen anderen Kontinent sehen, auch eine andere Sprache hören und andere Mentalitäten kennenlernen. Denn so viel wusste ich schon, dass das, was ich von zu Hause kannte, irgendwie nicht stimmen konnte. Bei uns in Goisern ging es nämlich sehr katholisch zu: nicht unbedingt in religiösem Sinne, aber doch im Hinblick auf das alltägliche Leben. Trotz der evangelischen Übermacht dort drinnen, war man päpstlicher als der Papst: "So, wie wir es machen, ist es richtig und alles andere ist falsch!" Das spürst du dann doch als junger Mensch, dass das nicht stimmen kann. Und verifizieren kann man das nur, indem man rausgeht. Es war mir also egal, wohin ich gehe: Es war dann einfach leichter möglich, nach Südafrika auszuwandern als sonst irgendwohin. Darum bin ich dort in Südafrika gelandet.
Wie lange haben Sie dort gelebt?
Vier Jahre lang. Nach dreieinhalb Jahren habe ich einen Rappel bekommen, d. h. ich habe es dort nicht mehr ausgehalten, weil ich keine Perspektive gesehen habe. Das war eben auch noch zu Zeiten der Apartheid, wo Schwarze und Weiße extrem getrennt waren. Ich habe mich dort wirklich mit allen angelegt in der Firma, in der ich gearbeitet habe, weil ich Sportveranstaltungen organisiert habe, die Schwarze und Weiße zusammengebracht haben. Das war eine recht große Firma mit ungefähr 200 Angestellten. Dass ich das gemacht habe, ist vielen dort in dieser Firma negativ aufgestoßen, was mich dann aber wiederum erst recht zornig gemacht hat. Irgendwann war es dann einfach so unangenehm, dass ich mir dachte: "Entweder ich passe mich jetzt dieser einen Seite an oder ich werde wirklich zu jemandem, der Bomben bastelt und auch mal was hochgehen lässt." Weder das eine noch das andere war für mich eine Perspektive und so bin ich zurückgegangen.
In welchem Beruf haben Sie damals gearbeitet?
Ich habe Chemielaborant gelernt, weil meine Eltern, weil vor allem mein Vater es nicht toleriert hat, dass ich als Musiker mein Geld verdienen möchte. Und ich war einfach ein angepasstes Kind, auch in der Pubertät. Trotz aller Auflehnung und Kämpfe, die ich mir mit meinem Umfeld geliefert habe, war es mir doch sehr wichtig, dass ich mit den Menschen, die mir nahe sind, in Harmonie lebe. Als ich gemerkt habe, dass das nicht mehr möglich ist, bin ich weggegangen.
Was haben Sie denn in Südafrika musikalisch erlebt? Denn ich kann mir vorstellen, dass das Einflüsse waren, die auch in die Musik Eingang gefunden haben, die Sie selbst dann später gemacht haben.
Das war nicht wirklich so, denn das war bis auf die Zeit vor meinem 12. Lebensjahr die einzige Zeit meines Lebens, in der ich mit Musik ganz wenigbis gar nichts am Hut hatte. Meine damalige Frau empfand ebenso wie meine Eltern Musik als Bedrohung der Beziehung. Sie wollte nicht, dass ich Musik ausübe, und ich habe es dann auch ihr zuliebe gelassen. Das waren diese dreieinhalb Jahre, in denen ich überhaupt nicht musiziert habe. Ich habe natürlich Musik gehört, aber Südafrika war damals kein offenes Land: Da konnte man nicht einfach irgendwo in eine Kneipe gehen und sich dort die Musik eines anderen Kontinents oder eines anderen Landes reinziehen. Dort, wo ich hingehen durfte, war westliche Musik zu hören – so wie hier auch, höchstens mit einem etwas anderen Geschmack. Ich fand das alles sehr uninteressant. Dort, wo es interessant gewesen wäre, durfte man aber nicht hingehen, weil das zu gefährlich oder überhaupt verboten war.
Wann haben Sie dann begonnen, musikalische Entdeckungsreisen zu machen? In welche Länder sind Sie dann gefahren?
Ich habe das gar nicht so bewusst gesucht, ich habe mir nicht gesagt: "So, jetzt fahre ich mal da hin und dort hin, um mir anzuhören, wie die Menschen dort musizieren." Mir ging es, wenn ich woanders hingefahren bin, um dieses Lebensgefühl, das in einem anderen Land anzutreffen war, und nicht so sehr um die Musik, die man genau dort spielt. Denn ich finde auch, dass Musik grundsätzlich der Ausdruck eines Lebensgefühls ist, viel mehr das, als Ausdruck irgendeiner Tradition zu sein, die sich irgendwo entwickelt hat. Das Ganze ist selbstverständlich sehr eng ineinander verwoben, aber ich bin einfach gereist, um zu schauen und um auch mal gescheit Englisch zu lernen. Ich ging nach Kanada: Dort war ich dann Chicago sehr nahe und damit dem, was dort an Blues so passiert. Aber die Stadt Toronto, in der ich zweieinhalb Jahre lang gelebt habe, war, so toll ich sie empfunden habe, nicht wirklich eine Stadt der Kultur, war keine Stadt, bei der ich mir gedacht habe: "So, hier spielt es sich jetzt für mich ab! Da kann ich eintauchen." Die Zeit dort habe ich hauptsächlich damit verbracht, sehr viel zu üben und mich im Selbststudium mit Harmonielehre usw. zu beschäftigen. Ich habe mich sozusagen vorbereitet auf die Zeit, in der ich endlich sagen kann: "So, jetzt bin ich Musiker!" Aber damals habe ich noch herumgejobbt, habe österreichische Ski an kanadische Skifahrer verkauft. Ich habe halt einfach gejobbt.
Aber als Musiker sind Sie dann schon in die Welt gezogen, z. B. nach Ägypten, auf die Kapverdischen Inseln, nach Burkina Faso usw. Dort haben Sie als Musiker auch den Kontakt zu anderen Musikern gesucht.
Ja, das stimmt. Ein Knackpunkt war vielleicht auch meine Zeit auf den Philippinen. Das war nach meiner Zeit in Kanada: Bevor ich zurückgekommen bin, habe ich einen Abstecher auf die Philippinen gemacht. Ich wollte nur drei Wochen dort bleiben, bin dann aber über vier Monate geblieben. Ich habe dort mit Leuten in einer sehr einfachen Lebensweise gelebt: in Pfahlbauten ohne Strom und ohne fließendes Wasser, die man auch zur Fuß erreichen konnte. In diesen vier Monaten habe ich Musik kennengelernt, wie es sie auch einmal bei uns gegeben haben muss, bevor es das Radio gegeben hat. Das heißt: Wenn es Musik geben sollte, dann musste man sie selbst machen. Man konnte nicht irgendein Gerät anschalten, um sich beschallen, berieseln zu lassen. Die Leute dort haben sehr viel musiziert und ich selbst habe auch viel musiziert: Ich habe mit diesen Menschen zusammen viel gesungen, habe ihnen meine Lieder, meine Volkslieder vorgesungen. Da ist etwas passiert bei mir. Wenn mir gesagt worden ist: "Komm, sing uns doch mal was vor aus deiner Heimat", dann habe ich selbstverständlich auf Volkslieder zurückgegriffen und sogar auf Kinderlieder. Wenn man das gefragt wird, dann singt man keinen Song von den Beatles, denn so sehr man sich auch mit dieser Zeit und mit diesem Lebensgefühl der 60er Jahre identifiziert, ist das nicht die Musik, mit der man sich dann darstellen möchte. Ich zumindest wollte mich lieber über Volkslieder darstellen. Da ist wirklich etwas passiert in mir, denn da hat es immer wieder "klick" gemacht in meinem Denken. Dort auf den Philippinen habe ich meine Abneigung gegenüber und meine Scheu vor der eigenen Tradition ein bisschen abgelegt. Ich habe mir vorgenommen: "Wenn ich zurückkomme, werde ich mir das doch noch einmal näheranschauen und versuchen, zu den Wurzeln vorzudringen und nicht auf dieser Oberflächlichkeit stehen zu bleiben." Denn auch damals hat es ja schon solche Sachen wie den "Musikantenstadl" und dieses Volkstümliche und Schlagerhafte gegeben, mit dem ich einfach nichts anfangen konnte. Und die sogenannten "Echten" und Zweihundertprozentigen bei uns zu Hause waren halt diejenigen, die den Hut mit dem Gamsbart tief ins Gesicht gezogen trugen, die eine Lederhose anhatte und mir einfach unangenehm waren. In deren Gesellschaft habe ich mich nicht wohlgefühlt: Das waren nicht die meinen. Sie waren bei der Musik auch völlig intolerant im Hinblick auf meinetwegen die geringste Veränderung irgendeiner Phrase. Da habe ich mir nur gedacht: "Dann spielt es halt, wie ihr meint, aber ich habe damit nichts zu tun!"
Das heißt, Sie sind in der Fremde zum ersten Mal an die eigenen Wurzeln gegangen, haben sich des Eigenen besonnen und sozusagen die eigene traditionelle Musik gespielt. Die anderen, also diejenigen, mit denen Sie dort Musik gemacht haben, haben das vermutlich auch so gemacht. Zu welchen Begegnungen ist es dann da gekommen? Was war denn z. B. einmal eine sehr beglückende und gleichzeitig sehr spontan zustande gekommene Begegnung musikalischer Art?
Ich habe mich natürlich in erster Linie für deren Musik interessiert: Ich wollte deren Instrumente lernen. Das waren grundsätzlich nur Instrumente, dieaus Bambus geschnitzt waren. Da gab es also keine Gitarren oder so, dafür aber alle möglichen Arten von Flöten usw. Es gab z. B. auch ein Instrument, das sie "Bambusgitarre" nannten: Das war einfach ein dicker Bambusstamm, der Saiten ebenfalls aus Bambus hatte. Man konnte auf diesem Instrument mittels Stegen fünf, sechs, höchstens sieben verschiedene Töne stimmen. Das war also pentatonisch aufgebaute Musik. Das hat mich interessiert. Und weil ich immerzu gesagt habe: "Singt mir was vor! Singt mir was vor! Wie geht das genau?", habe ich nicht nur deren Lieder gelernt. Denn irgendwann kamen sie auf mich zu und meinten, ich solle ihnen auch mal etwas von mir zu Hause vorsingen und ihnen ein Lied von mir zu Hause beibringen. Da gab es dann diesen Austausch, einen Austausch, bei dem es keine unangenehmen Berührungen gegeben hat: Das war alles sehr, sehr offen. Interessant war vielleicht mein Treffen mit den Kalingas: Das sind die Kopfjäger – damals waren das noch Kopfjäger – ganz oben im Norden von Luzon, also der Hauptinsel. Als ich in Manila gewesen bin, habe ich nämlich gehört, dass dort oben noch ursprüngliche Musik zu hören sei. Es sei aber gefährlich, dorthin zu fahren, weil das Kopfjäger seien. Außerdem herrschte damals auf den Philippinen noch die Diktatur von Ferdinand Marcos, was wiederum bedeutete, dass es noch jede Menge kommunistische Rebellen gegen dieses Regime gegeben hat. Von dieser Gegend in Luzon aus sind diese Rebellen immer losgezogen und haben irgendetwas überfallen. Ich habe mich aber damals komischerweise absolut nicht gefürchtet. Wenn heute mein Sohn zu mir sagen würde, er möchte in so eine Gegend fahren, dann würde ich sagen: "Nein, bitte, muss das sein? Gibt es nicht andere schöne Gegenden, in denen es nicht so gefährlich ist?"
Das hätte Ihr Vater damals zu Ihnen vermutlich auch gesagt.
Er hat das gar nicht gewusst, aber ich habe auch, wie gesagt, keine Angst gehabt: Ich habe die Gefahr nicht gespürt. Und wenn ich eine Gefahr nicht spüre, dann ist sie für mich auch nicht da. Da vertraue ich mir einfach selbst und vertraue auch den Menschen auf dieser Welt: Egal wo ich hinkomme, der Großteil der Menschen, wirklich mehr als 90 Prozent, sind einfach einander wohlgesonnen. Es gibt sicherlich überall ein paar Hitzköpfe, denen man nicht unbedingt in der Nacht begegnen sollte.
Was mich fasziniert hat, war eine Episode aus dem Film Grenzenlos, der Ihre Reisen durch Afrika dokumentiert und der auch auf DVD erschienen ist. In dieser Episode geht es um Burkina Faso und um das, was hinter der traditionellen Musik dort eben auch noch alles stehen kann. Die Musiker sind dort nämlich, ähnlich wie Medizinmänner, dafür zuständig, dass der Regen kommt. Sie spielen also, um mit ihren Instrumenten den Regen herbeizuspielen. Das ist doch noch einmal eine ganz andere Dimension von Musik.
Ich glaube, dass die Musik grundsätzlich eine Magie hat, die den Leuten auch bewusst ist – auch hier bei uns. Selbst bei so etwas wie den Salzburger Festspielen ist das so: Die Musik strahlt eine Magie aus, die Leute gehen in ein Konzert, um sich verzaubern zu lassen. Bei uns ist das alles halt schon sehr reglementiert: Die Musik gibt es nur an dem und dem Ort, zu der und der Zeit und nur in der und der Form. Auf einem Kontinent wie Afrika ist die Musik hingegen viel stärker mit dem Alltag verwoben. Dort gibt es z. B. diese Situation nicht, dass man als Musiker, als Akteur eine Bühne hat, während unten die Leute sitzen oder stehen, die sich diese Musik reinziehen. Stattdessen ist das Musizieren in Afrika immer ineinander verzahnt. Das heißt, es wird Musik gespielt, weil es einen Anlass gibt, aber nicht, weil man sagt: "Jetzt würden wir doch gerne wieder mal Musik hören, also lass uns in ein Konzert gehen!" Das Konzertante gibt es in Afrika nicht, Musik hat stattdessen noch einen Zweck. Bei uns hat die Musik auch einen Zweck, aber dieser Zweck ist bei uns unter diesen vielen Schichten doch sehr verdeckt und versteckt, die inzwischen die Musik überlagern, und auch durch das Geldverdienen, das damit verbunden ist. Ich würde nicht behaupten, dass die Kunst oder die Magie der Musik korrumpiert ist, aber sie ist einfach beladen mit sehr viel Unnötigem. In Afrika machen die Musiker selbstverständlich auch nicht das Wetter mit ihren Balafonen. Sie spielen den Regen zu einer Zeit herbei, wo er eh kommen muss.
Davon haben ja auch Sie profitiert, weil dieses Konzert eben zu einem Zeitpunkt stattgefunden hat, an dem der Regen kommen sollte.
Genau, wir sind gerade rechtzeitig zum Mangoregen gekommen. Aber das hat uns dann schon auch verbunden mit den Musikern dort: Wir waren wirklich Teil dieser magischen Kultur, weil gerade, als wir gespielt haben, ein Regenguss eingesetzt hat.
Sie haben vorhin erzählt, dass Sie mit einer Art Urvertrauen in die Welt reisen, dass Sie z. B. auf den Philippinen auch in eine Gegend gereist sind, die immer wieder von Terroristen heimgesucht worden ist. Es gibt ja auch Menschen, die das ganz anders sehen: Es gibt Menschen, die Angst haben vor dem Fremden. Sie selbst haben sich immer wieder engagiert gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Fremdenhass z. B. gerade in Kärnten und gegen dortige rechtspopulistische Politiker. Sie selbst haben ja Lust am Fremden, am Betreten von neuem Terrain und am Kennenlernen von Neuem. Können Sie Menschen verstehen, die Angst vor dem Fremden haben?
Ja, das kann ich sehr gut verstehen, denn der Mensch ist ein Gewohnheitstier und alles, was aus der Routine ausbricht, sorgt sofort für einen höheren Puls. Ich glaube, je älter man wird, desto mehr fürchtet man sich vor zu viel Aufregung. Man hätte einfach gerne, dass man sich darauf verlassen kann, dass dann, wenn man ums Eck geht, der Baum genauso dasteht wie gestern. Wenn er umgesägt worden ist, dann regt einen das bereits auf. Wenn man jedoch ein junger Mensch ist, dann denkt man höchstens: "Schau, jetzt haben sie den Baum da umgesägt. Na ja, wird schon wieder einer nachwachsen. Sie werden schon einen Grund dafür gehabt haben und es gibt noch so viele andere Abertausend Bäume." Jeder ist ganz sicher geprägt durch persönliche Begegnungen und Ereignisse, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der keine schlechte Erfahrung gemacht hat mit dem Fremden oder einem fremden Menschen, xenophobisch ist, also fremdenfeindlich oder fremdenängstlich. Ich glaube, diese Ängstlichkeit kann nur dann entstehen, wenn da eine Begegnung vorhanden gewesen ist, die als unangenehm empfunden wurde. Aber wir leben nun einmal in einem sozialen Austausch und auch in einem Wissensaustausch und es gibt heute eben ein paar Leute, die möglicherweise schlechte Erfahrungen gemacht haben und die nun glauben, allen anderen Menschen erzählen zu müssen, dass die Welt so ist, wie sie sie sehen. Ich selbst möchte nicht hinausgehen in die Welt und sagen: "Ich habe keine schlechten Erfahrungen gemacht, also gibt es das nicht, dass man schlechte Erfahrungen machen kann." Aber es ist eben so, dass man schlechte Erfahrungen auch zu Hause mit dem eigenen Nachbarn machen kann. Ich kenne sehr viele Leute, die mit ihrem Nachbar seit Generationen verfeindet sind. Es gibt also dieses Misstrauen tatsächlich, weil irgendwann mal vor meinetwegen zwei oder drei Generationen etwas passiert ist, sodass die Enkelkinder einander immer noch misstrauen, weil es heißt: "Die da drüben auf dem anderen Hof sind so! Da musst aufpassen bei denen!"
Woher kommt denn bei Ihnen dieses Urvertrauen? Ist Ihnen das irgendwie schon zu Hause mitgegeben worden?
Ja, schon auch zu Hause. Aber ich habe ja auch nicht in alles ein Urvertrauen. Ich vertraue z. B. den Lehrern nicht. Ich habe stattdessen ein Urmisstrauen gegenüber Lehrern, weswegen ich mich immer wieder mal selbst an der Nase packen und mir sagen muss: "Gut, du hast schlechte Erfahrungen gemacht mit Lehrern, aber das muss ja nicht für alle gelten."
Es sind eben immer bestimmte Erfahrungen, die zu solchen Einschätzungen führen.
Genau.
Da Sie sich ja auch politisch engagiert haben gegen Rechtsradikalismus und gegen die Ausgrenzung von Fremden, frage ich: Was kann man ausIhren persönlichen Erfahrungen lernen? Wie kann bei Menschen, die Angst vor dem Fremden haben, ein solches Urvertrauen bzw. Vertrauen aufgebaut werden? Liegt das an mangelnder Information, an fehlendem Wissen, an nicht vorhandener Bildung?
Sicherlich hat das auch etwas mit Bildung zu tun. Bei mir war es so, dass ich ja derjenige gewesen bin, der hinaus in die Welt gegangen ist. Alleine schon das ist ja nicht jedermanns Sache: Die meisten meiner Freunde sind zu Hause geblieben. Ich habe es mir selbst ausgesucht, auf das Fremde zuzugehen. Heute hingegen ist es so, dass in dieser globalisierten Welt das Neue einfach überall hinkommt; die Leute brauchen gar nicht erst vor die Tür gehen, das Neue dringt durch alle Fugen und Ritzen und Poren ein. Das mag verunsichern, aber es ist einfach eine Tatsache, und hier spielt dann eben die Bildung eine Rolle, dass wir in einer Welt leben, die sehr, sehr stark vernetzt ist. Die Welt war immer schon vernetzt und so zu tun, als hätte es das früher nicht gegeben, dass wir voneinander abhängig gewesen wären, ist falsch. Auch früher schon war es so, wie es in diesem Sprichwort heißt: Wenn hier ein Schmetterling mit seinen Flügeln schlägt, kann deswegen ganz woanders auf der Welt ein Erdbeben geschehen. Aber wir haben das nicht gewusst, wir hatten nicht die Informationen darüber, dass wir z. B. nur deshalb bei uns so günstig Bananen kaufen können, weil dafür meinetwegen in der Karibik Menschen sterben, weil auf den Bananenplantagen mit Unmengen von Pestiziden gearbeitet wird und weil diejenigen, die auf solchen Plantagen arbeiten, weniger als einen Hungerlohn bekommen usw. Heute hingegen wissen wir das und deshalb können wir nicht mehr so tun, als wäre es möglich, das Rad der Zeit zurückzudrehen und zu dieser Naivität zurückkehren zu können. Wir haben diese Naivität verloren: Das tut weh, aber man muss dem ins Auge schauen und nun verantwortungsbewusster umgehen mit den Ressourcen. Dazu gehört auch der Umgang mit den Mitmenschen, dazu gehört, dass man versteht, dass Leute weggehen von woanders. Ich bin ja selbst auch rausgegangen und wurde dann von anderen Menschen irgendwo auf der Welt aufgefangen, weil sie zu mir gesagt haben: "Gut, du bist jetzt hier bei uns. Also, hier hast du einen Job, hier kannst du ein Haus mieten." Mir wurde also in anderen Ländern und Kontinenten von anderen Menschen immer dabei geholfen, dass ich dort die Füße auf den Boden bekommen habe. Das führt natürlich dazu, dass ich mir denke: Wenn da jemand heute zu uns kommt und es gibt einen Job für ihn und es gibt einen Platz, an dem er leben kann, dann soll er auch hier arbeiten und hier leben. Soll er das nur deshalb nicht dürfen, weil ihm das von irgendeinem Gesetz verboten wird? Nein, denn so etwas habe ich eh noch nie verstanden. Vor meiner ersten Reise hatte ich nach Deutschland gehen wollen. Aber es war damals zu Beginn der 70er-Jahre nicht möglich, dass ich als Österreicher in Deutschland als Chemielaborant eine Arbeitsgenehmigung bekommen hätte – zumindest nicht ohne wahnsinnigen bürokratischen Aufwand, ohne Ämterstress usw. Denn ich hatte einen Job, der für den deutschen Arbeitsmarkt nicht wirklich interessant war und es gab in Europa einfach noch diese Grenzen zwischen den Ländern. Man konnte also nicht von einem Land ins andere gehen und dort arbeiten.
Sie haben erzählt, dass Sie sich auch in politische Spannungsfelder begeben haben wie z. B. in Südafrika mit dem dort herrschenden Apartheidsystem oder auf den Philippinen in diese Gegend mit den revolutionären Bewegungen. Sie haben aber auch Kontakt aufgenommen zum Dalai Lama und sind damit bewusst in ein politisches Spannungsfeld hineingegangen. Sie haben China besucht, Sie haben das von den Chinesen besetzte Tibet besucht und Sie haben den Dalai Lama im Exil besucht. Wo sehen Sie denn als Musiker Ihre Rolle, möglicherweise eine politische Botschaft zu vermitteln?
Das hat nichts mit meinem Dasein als Musiker zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass meiner Meinung nach jeder Mensch eine politische Eigenverantwortung hat. Wenn man so viel in der Öffentlichkeit ist wie ich und so ein Ansehen genießt, dann habe ich eben das Gefühl, dass ich dem dadurch Rechnung tragen muss, dass ich mir über das eine oder andere Gedanken mache und auch über meine Erfahrungen spreche und nicht nur Lieder schreibe. Ich bin niemand, der das alles in Liedern ausdrücken möchte. Ich bin nun einmal kein politischer Liedermacher, ich mag das nicht. Ich habe es nicht gerne, wenn mir irgendeine politische Botschaft über ein Lied präsentiert wird. Da denke ich mir immer: Es ist schade um die Musik. Die Musik ist nämlich viel größer, als es die Politik je sein kann. Aber Politik ist nun einmal Teil unseres Lebens. Ich verstehe es, wenn jemand sagt, dass er damit nichts zu tun haben möchte. Aber es ist einfach eine Tatsache, dass jeder etwas damit zu tun hat: Man kommt dem nicht aus!
Das heißt, Sie haben als Musiker das Gefühl, eine Art öffentliche Verantwortung zu haben – auch für das, was Sie über die Musik hinaus tun und sagen.
Ja, aber das hat nichts mit meinem Musiker dasein zu tun. Die Aufmerksamkeit, die ich bekomme, möchte ich nicht nur dafür nutzen, ein Lied nach dem anderen zu spielen. Aber das wäre nicht anders, wenn ich
Bildhauer wäre oder Gärtner oder Lehrer. Man macht einfach seine Erfahrungen und gibt diese dann weiter – und sei es nur im Kreise der Familie oder im Kreise der Freunde – und tauscht dabei Meinungen aus. Der einzige Unterschied ist, dass dann, wenn wir wie hier jetzt im Studio sitzen, die Leute nicht zurückreden können. Aber wenn ich z. B. irgendwo zu Besuch bin und man redet über Afrika oder über die Situation in Tibet, dann können die Leute Fragen stellen und z. B. sagen: "Ich glaube, dass das nicht so ist, wie du sagst." Und dann kann ich wiederum darauf reagieren. Das ist der einzige Unterschied zwischen den Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen und privaten Leuten. Aber das Thema als solches ist für alle das gleiche: das Zusammenleben von uns allen in irgendeiner Form so zu gestalten, dass es passt, dass jeder genug zu essen hat, dass jeder ein Dach über dem Kopf hat, dass jeder eine gewisse Sicherheit im Leben hat. Gut, wenn es ganz sicher wird, dann wird es auch wieder fad und zu beengend. Aber das muss dann jeder für sich spüren. Ich bin keiner, der gerne auf einer Insel leben möchte, auf der außer mir selbst kein weiterer Mensch lebt. Ich mag es, dass ich in einer Gemeinschaft lebe, ich mag unterwegs sein, ich mag gerne irgendwo hinkommen, wo andere Leute zu Hause sind, ich mag mir gerne deren Geschichten anhören. Und weil ich das alles mag, möchte ich auch, dass wir gut miteinander auskommen und dass nicht diese gegenseitige Ignoranz oder gar Xenophobie herrscht, die mir bedeutet: "Lass mich in Ruhe! Geh wieder heim!"
Sie mögen also nicht gerne alleine auf einer Insel sitzen – es sei denn, das wäre vielleicht eine Donauinsel, womit wir quasi mit dem Finger auf der Landkarte bei Ihrem letzten Projekt wären. Das war eine Reise mit einem Konzertschiff auf der Donau. Da ging es zuerst einmal die Donau abwärts zum Schwarzen Meer und dann hinauf und über den Rhein-Main-Donaukanal bis nach Rotterdam. Diese Reise ist auch dokumentiert worden, d. h. es gibt ein neues Buch von Ihnen mit dem Titel Stromlinien, in dem Sie diese Reise, wie ich finde, auf wunderbare und sehr spannende Weise beschreiben. Dieses Projekt ist in Zusammenhang mit der Europäischen Kulturhauptstadt Linz 2009 realisiert worden. Nun liegen die Dokumentationen vor: sowohl in Buchform wie auch als DVD. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, die Donau hinauf und hinunter zu schippern?
Ich muss eine kleine Korrektur anbringen, weil Sie gesagt haben, das wäre mein "neues Buch": Das ist mein erstes Buch!
Es ist Ihr erstes Buch überhaupt?
Ja, denn sonst kommt vielleicht noch jemand auf die Idee und möchte meine alten, meine vorherigen Bücher haben und kennenlernen. Aber die gibt es nicht, denn das ist mein erstes.
Entstanden ist dieses Buch aus dem Logbuch, das Sie geführt haben während dieser Donaufahrt.
Genau. Ungefähr die Hälfte dessen, was in diesem Buch drin ist, ist das, was als Logbuch zu lesen war in meinem Blog, das ich während dieser Reise im Internet geschrieben habe. Ich habe das dann aus dem Internet herausgenommen und noch einige Reflexionen dazu geschrieben, die die andere Hälfte dieses Buchs ausmachen. Das Logbuch habe ich eigentlich unangetastet gelassen, obwohl ich mir schon oft gedacht habe: "Eigentlich könnte man dieses und jenes jetzt wirklich streichen." Aber ich wollte es so drinnen lassen, damit man nacherleben kann, wie es mir damals gegangen ist. Und statt Streichungen vorzunehmen, habe ich meine Reflexionen aus der Distanz hinzugefügt, als ich diese Reise dann doch mit etwas mehr Gelassenheit sehen konnte und nicht mehr diese Vehemenz der Aktualität im Tagesgeschehen vorhanden war. Auf die Idee, diese Reise zu machen, bin ich gekommen, und das ist auch ganz am Anfang dieses Buches beschrieben, als ich 1996/97 zwei Mal Tansania besucht habe und dort am Tanganjikasee eine Situation vorgefunden habe, bei der die Leute einander doch mit großer Angst begegnet sind. Das war diese Zeit des großen afrikanischen Weltkriegs, als im Kongo, in Burundi, in Ruanda überall diese Gräueltaten passiert sind. Tansania war damals eines der wenigen Länder in Afrika, wenn nicht sogar das einzige Land, das nicht in diesen Krieg verwickelt war. Aus diesem Grund hat Tansania dann auch in der Region Kigoma über eine Million Flüchtlinge aufgenommen, die in verschiedenen Lagen untergebracht wurden. Diese Lager habe ich besucht, weil es mich interessiert hat, was in so einem Flüchtlingslager abgeht, wie diese Menschen dort leben. Das war sehr erschütternd. Aber ich habe in all diesen Lagern eben auch Musiker kennengelernt – so wie das eben manchmal der Fall ist, weil es bestimmte Energien gibt, durch die Leute angezogen werden und sich treffen, ohne verabredet zu sein. Ich habe damals ein kleines Festival veranstaltet, obwohl viele Leute gesagt haben: "Mach das nicht! Du kannst doch jetzt nicht diese verschiedenen Ethnien an einem Platz zusammenbringen, denn diese Leute werden übereinander herfallen." Ich selbst hatte diese Befürchtungen jedoch gar nicht und es ist auch nichts passiert, sondern es entstand ein großartiges Fest der Begegnung. Das war sozusagen ein unplugged-Festival, d. h. es gab keine Mikrofone und irgendwelche Verstärker. Aus diesem Grund waren diese Konzerte nur für wenige Leute hörbar und nachvollziehbar und mitvollziehbar. Ich glaube, es waren insgesamt nicht mehr als 300, 400 Leute auf diesem Festival. Aber damals fasste ich den Entschluss, etwas Großes zu machen: Ich wollte mit einem Schiff rund um diesen See fahren und Musik machen mit Musikern aus all diesen Ländern und Ethnien. Ich hatte den Traum, dass sie füreinander Musik machen, füreinander spielen. Diese Schiffs-Musik-Tour ist dann immer weiter in meinem Kopf herumgegeistert. Irgendwann hat dann ein Freund zu mir gesagt: "Mach das doch auf der Donau! Probier das doch mal aus, wie das ist. Da kannst du auch mit dem Schiff fahren und Musik machen." Das war zu einer Zeit, als sich gerade die EU öffnete in Richtung Südosteuropa und zwei Jahre, bevor Bulgarien und Rumänien dazugekommen sind. Das war auch diese Zeit, in der man bei uns in den Medien immer nur diese Horrormeldungen gelesen hat: "Wenn diese Länder auch noch dazu kommen, dann bricht das Ganze zusammen! Denn wenn in dieser Richtung die Grenzen geöffnet werden, dann kommen diese Leute alle zu uns und nehmen uns die Arbeit weg und dann ..."
Da war sie wieder, diese Angst vor dem Fremden.
Genau. Ich habe mir gedacht: Merkwürdig, da ist scheinbar doch die Notwendigkeit vorhanden, dass man stattdessen endlich mal etwas miteinander macht. Also habe ich das angeleiert und hatte dann das Glück, Geldgeber zu finden. "Linz09" hat großartigerweise 1,2 oder 1,3 Millionen Euro ausgegeben, um dieses Schiff umzubauen. Das ist dann wirklich ein riesengroßes Projekt geworden. Am Anfang, als ich die erste Kalkulation gemacht habe, habe ich gedacht, ich würde mit einem Betrag zwischen 300000 und 500000 Euro auskommen.
Letztlich war das aber nicht nur ein Schiff, sondern das waren drei Schiffe, die dann unterwegs waren.
Ja, schon, aber das Komplizierte dabei war, wirklich so etwas wie ein schwimmendes Dorf zu bauen. Denn ich wollte einfach, dass sie alle auf das Schiff kommen, dass wir wirklich wie eine Insel sind, die man betreten kann: Ich wollte einfach eine Art musikalisches Dorf erschaffen, um gemeinsam durch Europa zu schippern und einander kennenzulernen. Das hat sich auch super bewährt, weil die Zeit so etwas von stillgestanden ist, während wir auf diesem Schiff waren. Natürlich ist auch dort ein Tag nach dem anderen vergangen, das ist schon klar, aber es war so eine langsame Fortbewegung, dass die Zeit wirklich stillzustehen schien: Wir sind mit durchschnittlich 15 Kilometern in der Stunde gefahren, d. h. manchmal bewegten wir uns sogar nur fünf Stundenkilometer schnell bzw. langsam vorwärts – und teilweise sogar noch weniger. Wenn wir schnell waren, dann erreichten wir vielleicht mal 20 Stundenkilometer. Aber trotzdem sind wir quer durch Europa und dann auch wieder zurück gefahren. Wir haben in zwei Sommern 12000 Kilometer zurückgelegt, haben 50 Konzerte gespielt und haben, wie ich glaube, wirklich sehr viele Leute einander näher gebracht. Weil ich doch vorher erzählt hatte, wie ängstlich man bei uns war wegen dieser EU-Öffnung in Richtung Südosteuropa: Ich habe in Bulgarien und Rumänien bei meiner ersten Erkundungsreise im Jahr 2006 – also ein Jahr, bevor auch Rumänien und Bulgarien in die EU aufgenommen wurden, ein Jahr, bevor ich meine eigentliche Tour gemacht habe – die Leute auf der Straße gefragt, ob sie sich denn jetzt freuen, dass sie ab nächstes Jahr nun auch Mitglied in der EU sein werden. Nur höchstens jeder Zehnte hat gesagt, dass das toll ist und dass er sich freut. Die anderen haben alle gesagt: "Hm, das ist uns eigentlich nicht recht, wir haben Angst vor euch." Ich habe sie dann gefragt, warum sie denn Angst hätten und dass es doch super sei, wenn die Grenzen endlich fallen würden. Aber ich bekam zur Antwort: "Wenn die Grenzen fallen, wenn das alles offen ist, dann kommt ihr und nehmt uns das Letzte, was wir haben, auch noch weg." Ich hörte also eigentlich genau denselben Text, wie man ihn bei uns zu Hause hören konnte. Bei uns hat man jedoch immer kolportiert: "Die dort unten wollen alle unbedingt rein!" Man vermittelte den Eindruck, als würden dort in Bulgarien und Rumänien alle Leute schon in den Startlöchern scharren, bis sie uns endlich die Arbeit wegnehmen und uns unser letztes Hemd ausziehen können.
Ein großartiges Projekt! Das war sozusagen "Europa im Fluss". Sie waren dabei der Grenzöffner und hatten, obwohl der Eiserne Vorhang nicht mehr existierte, trotzdem noch einige Grenzen zu überwinden.
Ja, schon.
Ich würde zum Schluss gerne noch etwas aufgreifen, das ebenfalls im Rahmen des Europäischen Hauptstadtjahres Linz 2009 ein Thema gewesen ist. Das ist das Thema "Hörstadt Linz": Peter Androsch, der diese Hörstadt in Linz organisiert hat, hat immer wieder versucht, darauf aufmerksam zu machen, dass wir in unserem Leben ständig von Klängen umgeben sind: Wir sind z. B. auch im Kaufhaus von Klängen umgeben. Das heißt, wir sind sozusagen von einer musikalischen Umweltverschmutzung umgeben. Er hat hingegen während dieses Hauptstadtjahres die Stille propagiert, er hat Orte der Stille geschaffen in Linz. Was bedeutet denn für Sie als Musiker Stille?
Ich empfinde Stille als etwas Großartiges.
Brauchen Sie die Stille auch immer wieder, um Inspiration zu finden?
Die Musik wäre ja ohne die Pausen keine Musik: Sie wäre wirklich unerträglich. Die Pausen machen den Rhythmus, d. h. es macht nicht wirklich die Musik den Rhythmus. Es gibt zwar viel mehr Musik, als Pausen in der Musik sind, aber es sind diese Pausen, die dem Ganzen die Phrasierung, den Rhythmus, den Puls geben. Ohne diese Pausen wäre die Musik einfach nur eine akustische Wurst, die sich durchzieht, ein Dauerton, eine Kakophonie. Ja, es sind diese Zwischenräume, die ganz, ganz wichtig sind, damit wir überhaupt miteinander kommunizieren können.
Wo finden Sie Ihre Inspiration und die Stille?
Die Stille ist schwer zu finden. Aber es ist durchaus noch möglich. Ich sage jetzt nicht, wo das ist, denn sonst gehen alle dort hin und ich finde die Stille nicht mehr. Aber die Stille kann und muss eh jeder für sich selbst finden. In den Städten gibt es z. B. die Kirchen. Ich selbst bin aus der Kirche ausgetreten, aber ich besuche manchmal Kirchen, weil es dort diese Stille noch gibt.
Hubert von Goisern, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wir müssen leider hier Schluss machen, obwohl es sicherlich sehr interessant gewesen wäre, noch weiter zu sprechen. Herzlichen Dank dem Musiker, dem neuerdings auch Schriftsteller und dem Grenzöffner Hubert von Goisern. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Ihnen noch einen schönen Abend. Danke.
Bitte.